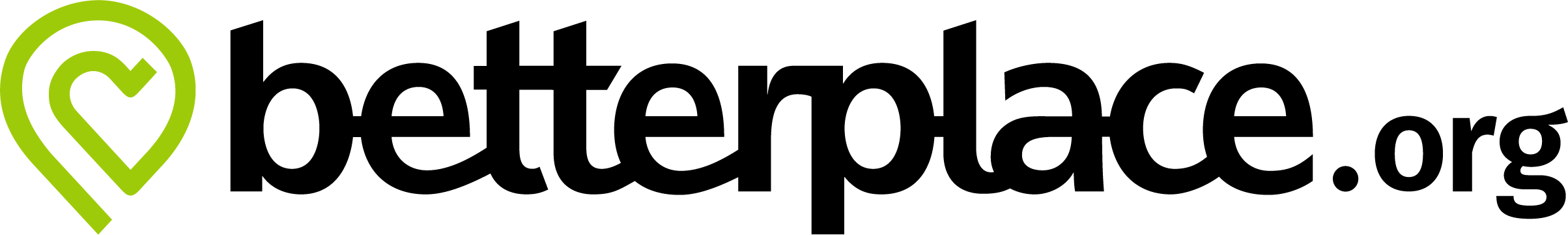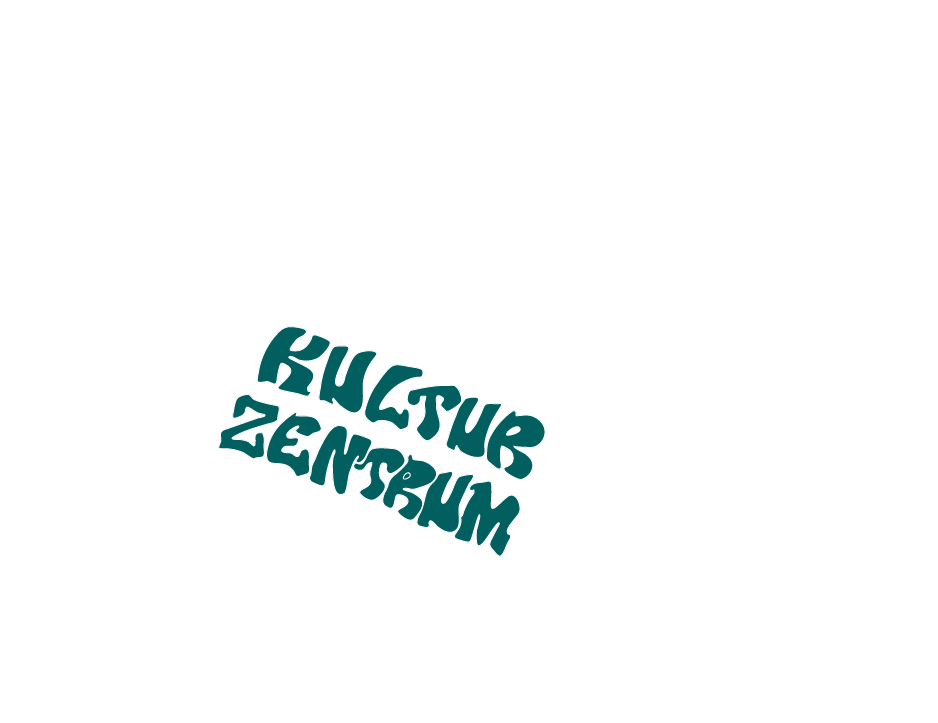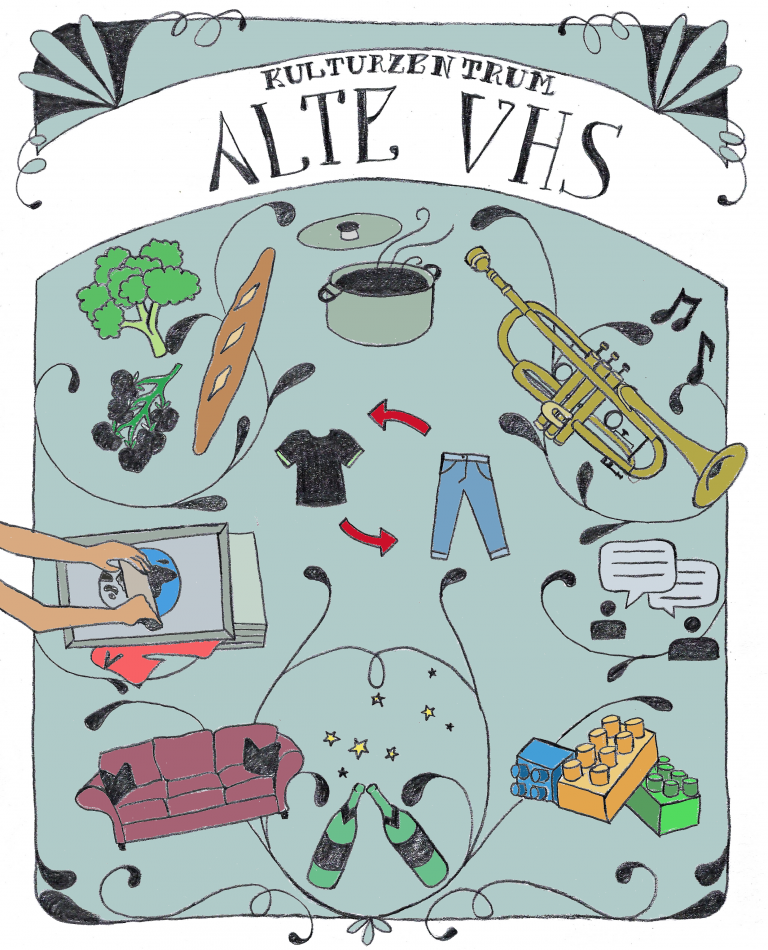Diese Frage stellten am 25. April die Amnesty International Hochschulgruppe und Studieren ohne Grenzen den Besucher*innen im Rahmen der Veranstaltung „Afghanistan – (k)ein sicheres Herkunftsland?“ in der Alten VHS. Begleitet von zeitgenössischer afghanischer Musik und landesüblichen Speisen konnten sich Interessierte auf diese Weise über die aktuelle politische und soziale Situation dieses beinahe in Vergessenheit geratenen Landes am Hindukusch informieren.
Auf klassische Infostände wurde diesmal (fast) komplett verzichtet. Stattdessen konnten sich die Besucher*innen im Gespräch mit einzelnen Delegierten der Initiativen persönlich austauschen und z.T. aus erster Hand einen Eindruck über die tatsächliche Lage der afghanischen Bevölkerung machen. Damit leisteten die Organisatoren wichtige Aufklärungsarbeit in der längst überfälligen Debatte über die politische wie ethische Vertretbarkeit geflüchteten Afghan*innen Asyl in Deutschland zu verweigern bzw. diese wieder in ihr Heimatland abzuschieben.
Laut Amnesty International Report aus den Jahren 2017/18 lebten 2017 ca. 2,6 Millionen afghanische Flüchtlinge in über 70 Ländern, von denen sich ungefähr 95 Prozent in den Nachbarländern Iran und Pakistan aufhielten. Ihr Verbleib war selbst dort nicht sicher, weil sie sich der ständigen Gefahr ausgesetzt sahen massenhaft abgeschoben zu werden. Und tatsächlich wurden zwischen 2002 und 2017 über 5,8 Millionen afghanische Staatsangehörige aus anderen Ländern in ihr Herkunftsland zurückgeführt, häufig ohne deren Einverständnis. Der UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) zufolge wurden aufgrund des bewaffneten Konflikts allein 2017 insgesamt 437.907 Menschen innerhalb des Landes vertrieben. Die Zahl der so genannten Binnenflüchtlinge, der IDP (Internationally Displaced People), stieg damit auf über 2 Mio. an.
Die humanitäre und soziale Lage dieser Menschen ist besonders prekär, weil es ihnen – entgegen wiederholter Zusagen der wechselnden Regierungen – an angemessenem Wohnraum, Nahrungsmitteln, Trinkwasser, Gesundheitsversorgung sowie Bildungs- und Beschäftigungschancen mangelt.
Im Klartext: 1,5 Millionen Menschen in Afghanistan haben keinen sicheren Zugang zu Essen. Für einen Großteil der Binnenflüchtlinge stellt es bereits eine Herausforderung dar nur eine Mahlzeit am Tag zu bekommen. Viele sind auf Essenreste vom Markt angewiesen oder müssen sich von verdorbenen Lebensmitteln ernähren. Diese Nahrungsmittel erschöpfen sich meistens in Getreide, Naan Brot und Gemüseresten mit Tee. Von einer ausgewogenen Ernährung kann dabei mitnichten die Rede sein.
Genauso wie die mangelhafte Ernährung, so stellt auch der Zugang zu tragbarem Wasser eine Rarität dar. Denn Wasserpumpen sind entweder nicht in ausreichender Anzahl vorhanden oder funktionieren nicht mehr. Das Recht auf Hygiene und damit auf sichere und verlässliche sanitäre Einrichtungen bleibt diesen Menschen somit verwehrt.
In puncto medizinische Versorgung wirkt die Lage kaum positiver. Reisen zu entsprechenden Einrichtungen sind nicht nur oftmals mit hohen Risiken verbunden. Hinzukommt dass Schulen und Krankenhäuser immer häufiger Ziele von Angriffen sind. Mögliche Alternativen in Form von staatlichen mobilen Kliniken gibt es nicht und wenn, dann werden nur wenige von NGOs zur Verfügung gestellt.
Ebenso mangelhaft ist die Lage der Kinder und Jugendlichem im Bildungssektor. Etwa 40 Prozent haben nicht die Möglichkeiten Grund- und weiterführende Schulen zu besuchen. Was einerseits auf den anhaltenden Konflikt und der zu geringen Anzahl von entsprechenden Bildungsinstitutionen zurückzuführen ist, andererseits jedoch und besonders im Fall der Binnenflüchtlinge, auch mit fehlenden finanziellen Mitteln. Zu hohe Materialkosten führen dazu, dass die Kinder selbst Geld verdienen müssen. Ein Teufelskreis, der sich einzig durch die Errichtung einer flächendeckenden Schulpflicht und Zugang zu freien Bildung durchbrechen lassen würde. Und obwohl diese Forderung gleichzeitig Teil der so genannten IDP Richtlinien ist, erscheint dieses Zukunftsziel für die afghanische Regierung gegenwärtig wenig realistisch.
Aber was bedeuten diese IDP-Richtlinien im Detail? Alles begann im Februar 2014 mit Erlassen eines Gesetzes zum Schutz der Rechte der IDP. Vorgesehen waren zum einen präventive Maßnahmen und Hilfen während der Notsituation und gleichzeitig Lösungen nach der Vertreibungsphase. Die Regierung sollte unabhängig davon für den Schutz verantwortlich sein. Ferner wurde sich auf folgende drei Punkte geeinigt: die Rückkehr der Binnenflüchtlinge in ihre Heimatregionen, die Integration vor Ort und die Möglichkeit umzusiedeln. Realistisch betrachtet fand die Umsetzung in den betroffenen Regionen aber nicht statt. Die Existenz dieser Gruppe wurde stattdessen geleugnet und das Problem ignoriert, indem diese als Wirtschaftsflüchtlinge gebrandmarkt wurden.
Die Ursachen für den mangelnden Erfolg der Mission lagen und liegen nach wie vor sowohl bei politischen sowie Sicherheitsbedenken. Aber auch Korruptionsanschuldigungen, fehlende Kapazitäten und Ressourcen sind dafür verantwortlich. Letztlich besiegelten die fehlende Priorisierung und das abnehmende Interesse internationaler Akteure ihr endgültiges Scheitern.
Tatsächlich waren Kontrolle und Einfluss der afghanischen Regierung auf die Bevölkerung im April 2016 bereits von 69 auf 64 Prozent gesunken. Im Oktober letzten Jahres hat sich diese Zahl mit nur noch 34 Prozent sogar fast halbiert. Zum Vergleich: der Einfluss der Regierung auf das Staatsgebiet lag damals bei lediglich 16 Prozent.
Genauer gesagt, sind gemäß UN Unterstützungsmission für Afghanistan (UMAMA) 26 Prozent der Bevölkerung, 27 Prozent der Fläche und 34 Prozent der Distrikte umkämpft. Dagegen ist der Erfolg im Kampf gegen die in den 90er Jahre gegründete Taliban-Bewegung bloß minimal. Aktuell sind diese sogar wieder auf dem Vormarsch. Darum verwundert es kaum, dass die Taliban den Beschluss der US-Regierung ihre Streitkräfte bis zum Frühjahr dieses Jahres restlos abzuziehen mehrheitlich begrüßten.
Bodengefechte zwischen regierungsfreundlichen Gruppen und Regierungsgegnern machen mit 31 Prozent beinahe ein Drittel der zivilen Opfer aus. Insgesamt 42 Prozent davon gehen auf selbstgebaute Sprengkörper von regierungsfreundlichen Gruppen zurück. In absoluten Zahlen gesprochen dokumentierte die UMAMA 2018 insgesamt 10.993 zivile Opfer, darunter 3804 Tote und 7189 Verletzte.
Zudem werden seit Beginn des „Kriegs gegen den Terror“ (2001) Drohnenangriffe durchgeführt, die bis heute für viele Menschen von Afghanistan bis zum Jemen zum Alltag geworden sind. Oftmals werden diese von Zivilisten durchgeführt, die im Dienst privater Sicherheitsfirmen stehen. Von Januar bis März 2019 gingen sogar mehr getötete Zivilisten auf das Konto afghanischer wie internationaler Kräfte (inkl. Nato) als auf das der Taliban und anderen bewaffneter Gruppen.
Der ehemalige US-Präsident Barack Obama war es, der das Drohnenprogramm entscheidend ausgeweitet hat. Die USA verstoßen damit regelmäßig gegen das Völkerrecht. Deutschland wiederum leistet dazu Beihilfe, indem es die Steuerung der Angriffe von Rammstein aus ermöglicht.
Ganze 94 Prozent der zivilen Opfer von internationalen Truppen können somit auf Luftangriffe zurückgeführt werden. Die Drohnenpiloten sehe ihre Opfer – abhängig von Wetterlage und Staub – meistens nicht. Fakt ist, die Bevölkerung nimmt Drohnenangriffe als gleichwertige terroristische Bedrohung wahr wie etwa Autobomben oder Al-Qaida.
Entgegen der Ansichten des designierten Heimatministers Horst Seehofer, stufen sowohl das Auswärtige Amt als auch die UMAMA Afghanistan nicht als sicheres Herkunftsland ein und bestätigen, dass Menschen jederzeit in lebensbedrohliche Situationen geraten können. Im aktuellen UMAMA-Bericht ist von mehreren verübten Selbstmordattentaten die Rede, u.a. auf den Flughafen der Hauptstadt Kabul, das Innenministerium sowie den Polizeiposten.
Aufgrund dieser Sicherheitslage war die deutsche Botschaft in Afghanistan lange geschlossen, Konsularabteilung und Visastelle sind es sogar bis heute. Und dennoch werden Menschen nach wie vor dahin abgeschoben. Denn gemäß der Bundesregierung seien Teile des Landes sicher.
Teilnehmenden der Veranstaltung wurde deshalb die Gelegenheit geboten, Briefe an das Innenministerium zu verfassen, in denen sie ihre eigene Einschätzung der Sachlage zum Ausdruck bringen und einen Appell an die Verantwortlichen richten konnten gegenwärtige Positionen zu überdenken und somit einen Impuls für eine andere politische Richtung zu geben.
Seitdem Abschiebe-Flieger nach Afghanistan starten, sprich seit Dezember 2016, hat Deutschland mehr als 500 Menschen dorthin zurückgeschickt. Darum ist ein zentrales Bemühen der teilnehmenden Initiativen, die Bundesregierung dazu aufzufordern, alle ihr zur Verfügung stehenden friedlichen Mittel einzusetzen, um eine Verbesserung der Lebensumstände vor Ort herbeizuführen, gleichermaßen zum Wohle der Binnenflüchtlinge als auch der Gesamtbevölkerung.